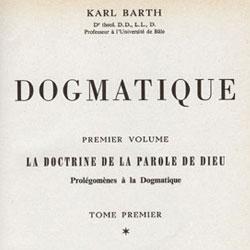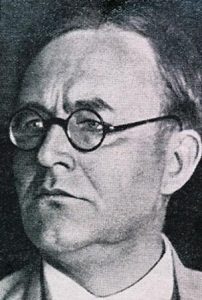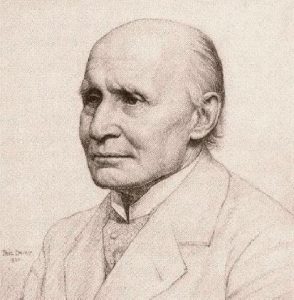Bis zum Ende der 20er Jahre
Diese Zeitspanne führt das 19. Jahrhundert weiter und bringt nichts Neues oder Unterschiedliches: Der Einfluss des Symbol-Fideismus von Auguste Sabatier (1839-1901) und Eugène Menegoz (1838-1921) ist beachtlich. Diese beiden Professoren von der Pariser Theologischen Fakultät gestehen den Lehrmeinungen einen symbolischen Wert zu und weigern sich, sie absolut zu setzen. Während dieser Zeit entwickelt Wilfred Monod (1867-1943) eine Theologie des Reiches Gottes, die im „sozialen Christentum“ vorherrscht. Für Monod steht diese Welt des Leidens im Gegensatz zu Gottes Willen. Christus muss ihre Feindseligkeit besiegen und sie erobern, um dort Gottes Reich zu errichten.
Von den 30er bis zu den 70er Jahren
In Deutschland erscheint eine neue theologische Generation, die mit der vorhergegangenen bricht. Der Krieg von 1914-1918 stellt einen Wendepunkt dar; er setzt dem Optimismus ein Ende, der auf den Fortschritt und auf die menschlichen Fähigkeiten vertraut. Der liberale Versuch, die Kultur mit dem Evangelium in Einklang zu bringen, erscheint vielen als Irrweg. Das Evangelium erschüttert, streitet und führt die Verwirklichungen der Menschheit in eine Krise. Das Heil kann nicht aus dem Besten der Menschheit kommen. Es impliziert die Einwirkung und die Offenbarung des „ganz anderen“ Gottes. Diese Theologie zeigt mehrere Strömungen auf. Die Wichtigste wird von dem Schweizer Karl Barth (186-1968) vertreten, der ein gewaltiges Werk sowohl in der Menge als auch in der Qualität hinterlässt, und dem seine entschiedene Opposition gegen das Naziregime großes Gewicht verleiht.
Ab 1930 verbreitet sich diese „neue Theologie“ schnell in Frankreich, nicht ohne zuweilen sehr heftige Polemiken zunächst gegen die Liberalen, aber auch gegen die als überholt betrachteten Orthodoxen (doch diese beiden Strömungen bestehen weiterhin).Der Einfluss von Barth ist unter anderem bei Pierre Maury (1890-1956), Roland de Pury (1907-1079), Jacques Ellul (1921-1994), Roger Mehl (1912-1997) spürbar, die das Leben des französischen Protestantismus nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmen.
Gleichzeitig entwickelt sich im Einklang (aber nicht identisch) mit dem „Barthismus“, die „biblische Erneuerung“, vor allem von Suzanne de Dietrich (1891-1981)angeregt . Diese Strömung vertritt eine Lektüre der Bibel, die ohne deren historischen Charakter zu verleugnen, darin eine von Gott kommende Botschaft sucht. Oscar Cullmann (1902-1999) sieht in der Heilsgeschichte den Schlüsselbegriff der Botschaft des neuen Testaments (die Offenbarung ereignet sich nicht nur in der Geschichte, sie ist Geschichte).
Die Theologen mit anderen Ausrichtungen bleiben am Rande; das trifft für Albert Schweitzer zu (1875-1965), dessen Arbeiten über das Neue Testament und die Ethik während dieser Zeit kein großes Gehör finden.
Ab der 70er Jahre
Neue theologische Strömungen erscheinen im französischen Protestantismus.
So denkt man über die Schriften aus dem Gefängnis des Märtyrerpastors der Nazis Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) nach. Er vertritt darin ein „nicht religiöses Christentum“, das mehr darauf bedacht ist, den Menschen zu helfen, als sich in der Gesellschaft durchzusetzen. Die „Theologen des Todes Gottes“ (besonders Amerikaner) radikalisieren dieses Thema, das Bonhoeffer nur angedeutet hat. Für sie befindet sich im Herzen des Evangeliums der Aufruf zu einem authentisch menschlichen Leben und nicht die Behauptung eines transzendenten Gottes.
Gleichzeitig interessiert man sich für die „Entmythologisierung“. Nach Rudolf Bultmann (1884-1976) benutzt das Neue Testament mythologische Kategorien der antiken Welt, die den unseren nicht mehr entsprechen. Man muss durch eine hinfällige Mythologie hindurch den existentiellen Sinn der Botschaft des Evangeliums wiederfinden.
Man übersetzt Paul Tillich (1886-1965)auf Französisch : er versucht in seinem Gedankengut die Philosophie mit der Theologie zu verbinden, ohne sie zu verwechseln. Obwohl er einerseits die Eigenständigkeit des Evangeliums behauptet und andererseits die der Kultur, versucht er, sie in eine Wechselbeziehung zu bringen.
Die aus Südamerika stammende Befreiungstheologie wird in Frankreich von Georges Casalis (1917-1987) vertreten und verteidigt; er tritt dafür ein, dass das theologische Denken von dem Erlebten ausgeht und nicht von Lehren a priori. Die kontextuellen Theologien ziehen die verschiedenen Kulturen in Betracht (aus Afrika, den Antillen, aus Ozeanien usw.) und die konkreten Situationen (die der Frau, des städtischen Lebens, der weltlichen Säkularisation, der wirtschaftlichen Ausbeutung).
Diese Theologie begünstigt klar links ausgerichtete politische Engagements (siehe das 1971 von der Protestantischen Föderation Frankreichs herausgegebene Dokument „ Kirche und Mächte“).
In den biblischen Studien betont man nach einem kurzen Durchbruch des Strukturalismus (der sich vor allem für die literarische Struktur der Texte interessiert) die Erzählstruktur, die nicht auf eine „biblische Erzählung“ reduziert werden darf; sie gründet auf der Oberhoheit der Sprache, die das Handeln und Sein bestimmt. Die Menschen schaffen sich ihre Identität durch Erzählungen. Folglich soll die Bibel eher erzählt werden, als Objekt eines gelehrten Kommentars zu sein.
Ohne einer Strömung zu folgen und ohne selbst Theologe zu sein, arbeitet der protestantische Philosoph Paul Ricoeur(1912-2005) viel über die Sprache und schlägt eine Überlegung über die biblische Hermeneutik vor (die Art, die biblischen Texte zu interpretieren), die breit angelegt, tief und komplex sein soll.
In den letzten zwanzig Jahren des Jahrhunderts erscheint ein oft polemischer Neo-Lutheranismus, der sich auf die „Theologie des Kreuzes“ beruft (Gott offenbart sich in seiner Schwäche, seiner Niederlage und seiner Ohnmacht und nicht in Ruhm und Macht) und der Verbindungen herstellt zu gewissen Strömungen der Psychoanalyse, der Geisteswissenschaften und der philosophischen Überlegung in der Naturwissenschaft. Gleichzeitig entdeckt man die amerikanische Theologie des „Process“, die Themen des Liberalismus wieder aufgreift, und die in Gott vor allem eine verwandelnde Dynamik sieht.
Andererseits verteidigt und erneuert zugleich ein Neo-Calvinismus sein Erbe. Es entwickeln sich auch „evangelikale“ Strömungen (die sich selbst „evangelisch“ nennen) mit einer starken und einfachen Botschaft.
Am Ende des 20. Jahrhunderts zeigt die theologische Lage des Protestantismus vier Merkmale
- Es gibt keine vorherrschenden Strömungen noch entschiedene Tendenzen. Man bemerkt eine Verzettelung ohne klare Zielrichtungen und mit zahlreichen gegenseitigen Einwirkungen. Der Protestantismus erkennt und erlebt, mehr noch als in der Vergangenheit, einen theologischen Pluralismus mit ständigen Debatten, aber selten heftigen Oppositionen. Das theologische Denken durchläuft eine Zeit der Suche und des Tastens eher als eine der kategorischen Behauptungen und Angriffe.
- Das Ende des 20. Jahrhunderts nimmt einige vorherrschenden Gedanken vom Beginn des Jahrhunderts wieder auf (der Wert der anderen Religionen, die Verbindung zur Kultur, die Artikulation des Glaubens und der Geisteswissenschaften, die Bedeutung der Spiritualität, die während der zweiten Periode hinan gestellt worden waren, um anderen Notwendigkeiten Platz zu machen.
- Die protestantische theologische Forschung findet nicht mehr wie zuvor im geschlossenen Raum statt. Sie ist weitgehend interkontinental geworden trotz der Entfernungen und der sprachlichen Hürden. Sie hat eine starke „ökumenische“ Dimension eingeführt. Katholiken und Protestanten arbeiten eng zusammen und pflegen häufigen Austausch. Die konfessionellen Unterschiede bestehen weiterhin, sie hindern aber die Theologen nicht mehr daran, zusammen zu arbeiten.
- Das 20. Jahrhundert stellt einen großen theologischen Reichtum dar. Die protestantischen Kirchen (besonders die reformierten und die lutherischen) bemühen sich, diesen Reichtum einer möglichst großen Zahl von Gläubigen zugänglich zu machen. Die theologische Ausbildung gehört zu den Hauptzielen, die sie verfolgen.